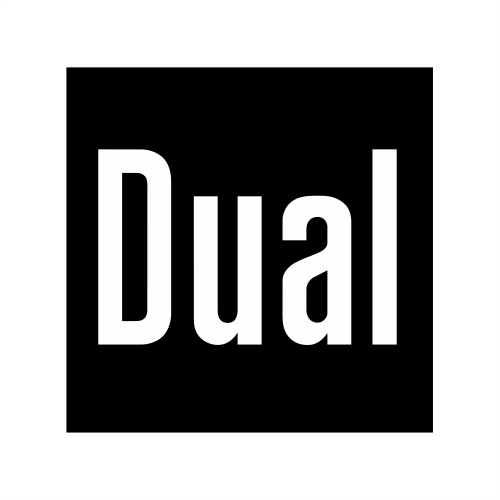Markenlexikon
Dual

Die Brüder Christian Steidinger II (1873 – 1937) und Josef Steidinger (1862 – 1925) begannen 1900 in St. Georgen mit der Herstellung von Federlaufwerken für die Schwarzwälder Uhrenindustrie. Anfangs betrieb noch jeder seine eigene Firma, 1907 kam es jedoch zum Zusammenschluss unter dem Namen Gebrüder Steidinger, Fabrik für Feinmechanik. Bereits ihr Vater Christian Steidinger hatte ab 1860 in St. Georgen eine eigene Werkstatt besessen. 1911 kam es zwischen den Brüdern zu Meininugsverschiedenheiten, in deren Folge Josef Steidinger aus dem gemeinsamen Unternehmen ausschied; kurz darauf gründete er ebenfalls in St. Georgen die Firma Perpetuum Schwarzwälder Federmotoren und Automatenwerke (ab 1936 Perpetuum-Ebner, Fabrik für Feinmechanik und Elektrotechnik), die ganz ähnliche Produkte wie die Firma seines Bruders herstellte (Federwerke für Sprechmaschinen und Orchestrions, Reklamewerke, Grammophone, Phono-Antriebe, Tonabnehmer, Plattenspieler).
1927 wurde erstmals der Firmen- und Markennamen Dual verwendet – benannt nach dem Dual-Motor, einer Kombination aus Federlaufwerk und Elektromotor für Grammophone. Nachdem die Firma ab 1928 Elektromotoren, Plattenteller und Tonabnehmer produziert hatte, kam 1937 erstmals ein kompletter Plattenspieler von Dual auf den Markt. Später wurden auch elektrische Rasierapparate (ab 1934), Kassettenrekorder (ab 1974) und HiFi-Anlagen (ab 1980) produziert. 1973 übernahm Dual die in Schwierigkeiten geratene frühere Firma seines Bruders (Perpetuum-Ebner).
Anfang 1982 musste Dual infolge der asiatischen Konkurrenz selbst Insolvenz anmelden. Kurz darauf wurde die Firma von dem Elektrokonzern Thomson aus Frankreich übernommen, was dazu führte, dass sich hinter vielen Dual-Geräten (vor allem HiFi-Anlagen; ab 1984/85 auch Videorekorder und CD-Player) nur noch Fremdprodukte von Thomson, Inktel oder Rotel (Japan) verbargen. Der gerade verstaalichte Thomson-Konzern hatte bereits die deutschen Firmen Nordmende (1978) und Saba (1980) erworben und 1983 übernahmen die Franzosen auch noch die Telefunken Rundfunk und Fernseh GmbH. Die qualitätsverwöhnten Händler und Kunden konnten mit den neuen Dual-Geräten nicht mehr viel anfangen, sodass die Marke von zahlreichen Händler ausgelistet wurde.
1987 gliederte Thomson die Dual GmbH in die Perpetuum-Ebner GmbH & Co. KG aus und verkaufte das Unternehmen 1988 an die Schneider Rundfunkwerke AG aus Türkheim, wohin 1993 auch der Dual-Firmensitz verlegt wurde. Im gleichen Jahr übernahm die 1963 von einem früheren Dual-Verfahrenstechniker gegründete Alfred Fehrenbacher GmbH (St. Georgen) die Produktion der analogen Dual-Plattenspieler, der Vertrieb blieb jedoch noch zwei Jahre bei bei Schneider (erst 2002 erwarb die Fehrenbacher-Tochterfirma Dual Phono GmbH die Vertriebs- und Namensrechte). Zeitweise vermarktete Schneider seine TV-Geräte auch unter dem Dual-Logo. 1995 erwarb der Warenhauskonzern Karstadt die Rechte an dem Namen Dual und entwickelte ein neues Logo zur Vemarktung eigener HiFi- und TV-Produkte, die von verschiedenen Herstellern stammten.
Anfang 2002 musste auch Schneider Konkurs anmelden, wurde jedoch Ende des Jahres vom chinesischen Elektronikkonzern TCL übernommen. Kurz darauf erwarb die südkoreanische Namsung Corporation die Dual-Markenrechte für den amerikanischen Doppelkontinent. Die Namsung-Tochter Dual Electronics Corporation (Heathrow/Florida) produziert in Kent/Washington Audio- und Videosysteme für Autos, Navigationssysteme und Lautsprecher.
2004 verkaufte KarstadtQuelle die europäischen Nutzungsrechte für die Marke Dual an das britische Unternehmen Linmark Electronics Limited (außer Plattenspieler), das die Vertriebsrechte für Deutschland, die Schweiz, Österreich, die Niederlande und Kroatien an die deutsche Firma DGC GmbH (Landsberg am Lech) vergab. Als Linford 2009 Insolvenz anmelden musste, erwarb DGC die Dual-Markenrechte für Europa. DGC vertreibt unter der Marke Dual u.a. Fernsehgeräte, Audiogeräte, iPod-Soundsysteme, Radiowecker, Plattenspieler, digitale Bilderrahmen und DVD-Player, die von asiatischen Auftragsproduzenten stammen. Fehrenbacher/Dual Phono stellt in St. Georgen weiterhin analoge Plattenspieler her.
Text: Toralf Czartowski