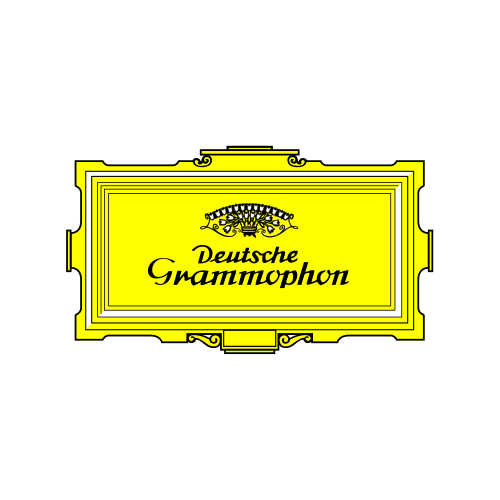Markenlexikon
Deutsche Grammophon

Joseph Sanders, ein Neffe des Schallplatten- und Grammophon-Erfinders Emile Berliner, und seine beiden Brüder Joseph und Jacob, die in Hannover die Berliner Telefonfabrik betrieben, riefen im Dezember 1898 in Hannover die Deutsche Grammophon Gesellschaft ins Leben. Im Januar 1900 wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgwandelt; 60 Prozent der Anteile befanden sich im Besitz der The Gramophone Co. Ltd. (London). Die Deutsche Grammophon Gesellschaft verwendete wie auch die Londoner Muttergesellschaft das berühmte Foxterrier-Logo »His Master's Voice« als Markenzeichen.
Zu Beginn des 1. Weltkriegs besaß The Gramophone Co. Ltd. bereits Presswerke, Studios und Verkaufsniederlassungen in Ägypten, Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Niederlande, Österreich-Ungarn, Polen, Schweden, Spanien und Russland. Zu dieser Zeit veröffentlichten die Plattengesellschaften vor allem Klassikmusik. Die Stars jener Tagen hießen Enrico Caruso, Edward Lloyd, Nellie Melba, Fjodor Schaljapin oder Leo Slezak, alles Opernsänger, die durch ihre Aufnahmen nicht nur der Schallplatte zum Erfolg verhalfen, sondern auch sich selbst.
Während des 1. Weltkriegs beschlagnahmte die deutsche Regierung die Deutsche Grammophon Gesellschaft als englisches »Feindvermögen« und verkaufte das Unternehmen 1917 an die Polyphon Musikwerke AG (Polydor), einen Hersteller von Spieldosen und Musikautomaten, die sich 1932 ganz in Deutsche Grammophon Gesellschaft umbenannte. Da sich die Namens- und Markenrechte außerhalb Deutschlands weiterhin im Besitz der The Gramophone Co. Ltd. befanden, konnte die Deutsche Grammophon Gesellschaft den Namen Deutsche Grammophon und das HMV-Logo nach dem Ende des 1. Weltkriegs im Ausland nicht mehr verwenden. Daher benutzte man ab 1924 die alte Polyphon-Marke Polydor (griech. »poly« = viel, »doros« = Geschenk), die zuvor u.a. auf Grammophon-Federmotoren und -Nadeln zu finden war. The Gramophone Co. Ltd. gründete 1925 in Nowawes bei Potsdam eine neue deutsche Tochtergesellschaft, die Electrola GmbH, die spätere EMI-Electrola GmbH.
1932 schloss sich Polyphon vollständig mit der Deutschen Grammophon Gesellschaft zusammen und übernahm auch gleich deren Namen. Unter dem Markenzeichen Polydor wurden fortan vor allem Schallplatten mit populärer Tanzmusik veröffentlicht, während das Label Deutsche Grammophon vorranging für klassische Aufnahmen Verwendung fand. 1937 übernahm die Deutsche Bank und die Telefunken Gesellschaft, seit 1932 selbst im Besitz einer eigenen Plattenfirma (Telefunken Platte), die Deutsche Grammophon Gesellschaft und 1941 wurde der Elektrokonzern Siemens neuer Eigentümer.
Nach dem Ende des 2. Weltkriegs wuchs die Deutsche Grammophon Gesellschaft schnell wieder zur führenden deutschen Plattenfirma heran. Und auch im Ausland gab es bald auf allen Kontinenten Polydor-Niederlassungen, die in der Polydor International GmbH zusammengefasst waren. 1950 zog Polydor von Hannover nach Hamburg um, 1956 folgte auch die Hauptverwaltung der Deutschen Grammophon Gesellschaft. Bis in die 1950er Jahre hinein gab es von Polydor auch noch Musikschränke (Plattenspieler/Plattenwechsler, Radio), wobei die Geräte meist von anderen Herstellern stammten (u.a. Siemens, Perpetuum-Ebner).
1962 gründeten Siemens und der niederländische Elektrokonzern Philips das Jointventure Gramophon-Philips Group und erwarben an ihren im Musikbereich tätigen Tochtergesellschaften Deutsche Grammophon Gesellschaft (DGG) und Philips Phonographische Industrie (PPI; ab 1967 Phonogram) wechselseitig Beteiligungen, Philips 50 Prozent an DGG und Siemens 50 Prozent an PPI. Als internationale Holding für die Siemens- und Philips-Musikaktivitäten entstand 1972 das Jointventure PolyGram (POLYdor + PhonoGRAM), an dem Philips und Siemens zu je 50 Prozent beteiligt waren.
Nachdem 1983 ein Zusammenschluss mit der Musiksparte von Warner Communications (WEA) am Einspruch der US-amerikanischen und deutschen Kartellbehörden gescheitert war, erwarb Philips weitere 40 Prozent der PolyGram-Anteile und 1987 auch den Rest. 1988 wurde Polydor eine eigenständige Firma (Polydor GmbH, Hamburg). 1989 brachte Philips die PolyGram N.V. teilweise an die Amsterdamer Börse (16 Prozent).1998 verkaufte Philips die PolyGram N.V. an den kanadischen Spirituosenkonzern Seagram, dem bereits die Universal Studios und die Universal Music Group, die frühere MCA Music Entertaiment Group, gehörten. Seagram integrierte PolyGram daraufhin in die Universal Music Group. Gleichzeitig wurde die Polydor GmbH in Universal Music GmbH umbenannt. Die Deutsche Grammophon GmbH, nun mit Sitz in Berlin, ist innerhalb der Universal Music Group neben Decca Classics und Mercury Classics weiterhin für die klassische Musik zuständig.
Text: Toralf Czartowski