Markenlexikon
Coca-Cola / Coke

Der Arzt und Apotheker John Stith Pemberton (1831 – 1888) hatte in seinem Labor in Atlanta/Georgia schon eine ganze Reihe von Arzneien, Heilmitteln und Kosmetika zusammengebraut, als er im Dezember 1885 gemeinsam mit dem Buchhalter Frank Mason Robinson (1845 – 1923) und zwei weiteren Geschäftspartnern die Pemberton Chemical Company gründete. Doc Pemberton war infolge mehrerer Verwundungen, die er sich im Amerikanischen Bürgerkrieg zugezogen hatte, morphiumabhängig, weswegen er mit der südamerikanischen Kokapflanze experimentierte, die ihn von seiner Sucht befreien sollte. Die Bewohner der Anden kauten seit Jahrhunderten Kokablätter, um damit Hunger, Durst, Kälte, Müdigkeit und die Auswirkungen der Höhenkrankheit zu verdrängen. Die Bergbaukonzerne in Peru und Bolivien bezahlten ihre Arbeiter zum Teil sogar mit Kokablättern, damit sie möglichst lange unter Tage arbeiten konnten. Die Gefährlichkeit des in den Kokablättern enthaltenen Alkaloids Kokain war damals nur wenigen Ärzten und Wissenschaftlern bekannt.
Im Frühjahr 1886 mixte Pemberton ein kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk aus Wasser, Zucker, peruanischen Kokablättern, koffeinhaltigen Kolanüssen aus Westafrika und einigen weiteren Zutaten wie Zitronensäure, Vanilleextrakt, Karamel, Orangenöl, Muskatnussöl, Zimtöl, Korianderöl, Neroliöl und Limonenöl zusammen. Das war damals allerdings absolut nichts Besonderes, es gab schon vorher diverse ähnliche Getränke aus Sodawasser und allerlei zugesetzten Aromen, Kräutern und Gewürzen. Seit der englische Chemiker Joseph Priestley, der Entdecker des Sauerstoffs, 1767 erstmals künstlich mit Kohlensäure angereichertes Wasser als billige Alternative zum natürlichen Mineralwasser hergestellt hatte, gehörten so genannte Sodabars zum amerikanischen Alltag. Hier wurde Sodawasser – mit und ohne Zutaten – als Erfrischungsgetränk angeboten, oftmals aber auch als Medizin. Das neue Gebräu verkaufte sich in den Drugstores der heißen Südstaatenmetropole Atlanta recht gut, vor allem als dort im Sommer 1886 ein örtliches Alkoholverbot in Kraft trat. Frank Robinson erfand den Namen Coca-Cola und schrieb ihn in geschwungener Buchhalterschrift nieder – fertig war das weltbekannte Markenzeichen, das bis heute nur noch wenig verändert wurde.
Nachdem Pemberton im August 1888 verstorben war, entbrannte – ausgelöst durch mehrere undurchsichtige finanzielle Transaktionen der Gründer, Finanziers und Erben – ein monatelanger Streit um die Herstellungsformel und Markenrechte, die schließlich der Drogist Asa Griggs Candler (1851 – 1929) für sich entscheiden konnte. 1892 gründete er gemeinsam mit Frank Robinson The Coca-Cola Company. Die neuen Besitzer machten sich nun daran Coca-Cola mit viel Werbung (Candler: »Wahrscheinlich kann kein Film unter freiem Himmel gedreht werden, ohne ein Coca-Cola-Schild einzufangen.«) und einem Heer von Vertretern, die in ganz Amerika die »Coca-Cola-Religion« predigten, zum Nationalgetränk zu erheben. 1894 gab es Coca-Cola in Flaschen (ab 1916 in der noch heute gebräuchlichen Konturflasche), 1899 wurden erstmals Lizenzen an fremde Abfüllfirmen vergeben, um den immer größer werdenden Markt beliefern zu können, und 1902 musste das Kokain, das bis zu diesem Zeitpunkt als harmloses Universalheilmittel gegolten hatte, aus der Limonade entfernt werden, nachdem in Georgia der Verkauf dieser Droge verboten worden war. 1919 verkaufte Candlers Sohn Howard The Coca-Cola Company an die Trust Company of Georgia (heute Sun Trust Bank), eine Regionalbank aus Atlanta.
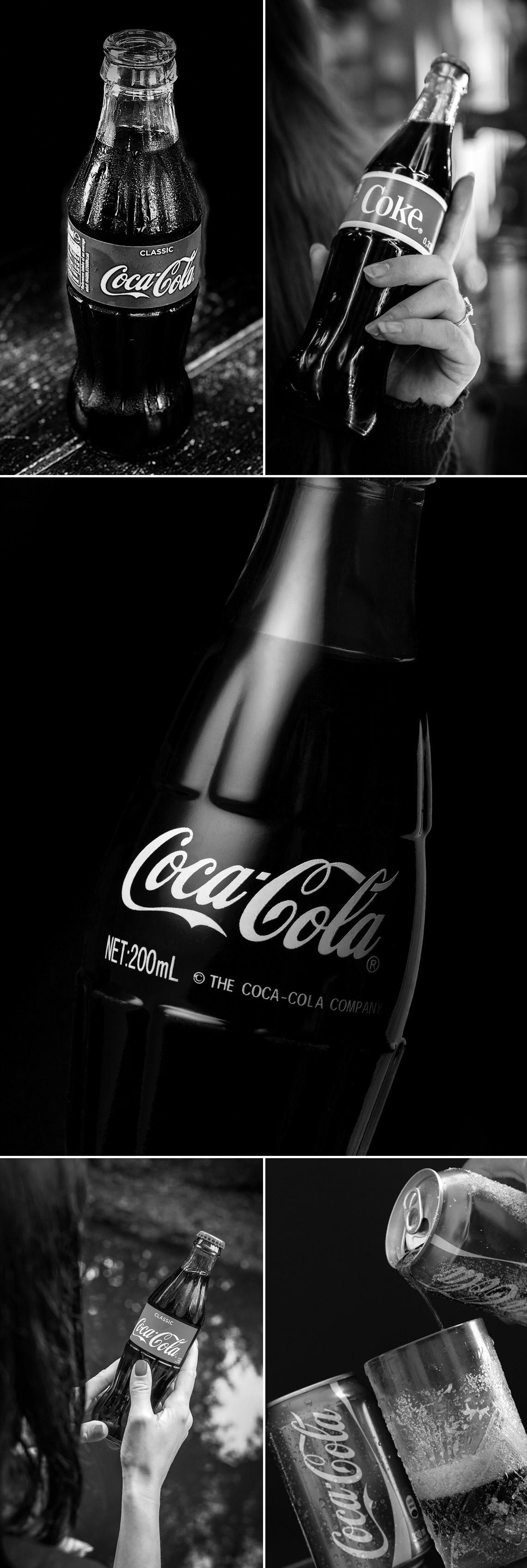
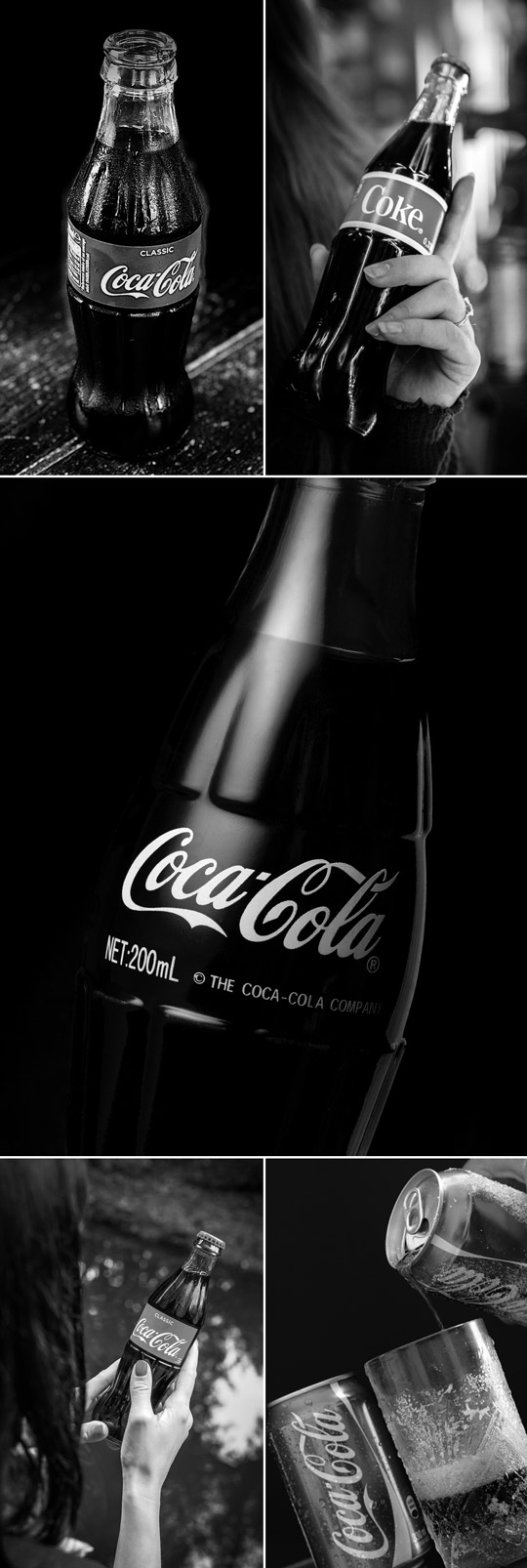
Ab den 1920er Jahren verbreitete sich Coca-Cola nach und nach über die ganze Welt. Das Mutterunternehmen produzierte jahrzehntelang lediglich das Konzentrat und lieferte es an die meist unabhängigen Abfüllunternehmen. Inzwischen ist der Konzern jedoch an mehreren großen Abfüllern in Amerika, Asien und Europa beteiligt. Der Geschmack von Coca-Cola variiert von Land zu Land geringfügig, was einerseits an der jeweiligen Beschaffenheit des Wassers liegt, andererseits an den verwendeten Süßungsmitteln (Rübenzucker, Rohrzucker, Maissirup, chemische Süßstoffe). Die früher in Coca-Cola enthaltene Zitronensäure wurde inzwischen durch Phosphorsäure (E 338) ersetzt. Ihre dunkle Farbe erhält Cola durch die Lebensmittelfarbe E 150d (Zuckerkulör).
Coca-Cola gibt es seit den frühen 1980er Jahren in zahlreichen Varianten wie Cherry, Diet, Lemon, Light, Lime, Orange, Vanilla oder Zero. Daneben stellen die Coca-Cola-Abfüllfirmen noch zahlreiche weitere Getränkemarken her, u. a. Apollinaris, Appletiser, Aquarius, BonAqua/BonAqa, Ciel, Dasani, Fanta, Fresca, Fruitopia, Hi-C, Kinley, Lift, Maaza, Manzana, Mello Yello, Mezzo Mix, Minute Maid, Pibb Xtra, Powerade, Simply, Sprite, Surge, TaB und Vio. Die Zweitmarke Coke wird offiziell seit 1941 verwendet.
Coca-Cola gehört seit langem zu den erfolgreichsten Marken der Welt. Die braune Limonade aus Atlanta gibt es nahezu in jedem Land der Welt zu kaufen und selbst in den entlegensten Dschungelnestern schreien einem die rotweißen Werbeschilder entgegen: »Trink Coca-Cola!« Der Aufstieg zur Weltmarke war einerseits die Folge der gigantischen Werbung, die für dieses Produkt betrieben wurde, andererseits trifft das Erfrischungsgetränk Cola aber auch den Geschmack der meisten Menschen. Bereits um die Jahrhundertwende gab es allein in den USA hunderte verschiedener Cola-Hersteller, die nichts mit Coca-Cola zu tun hatten und auch in anderen Teilen der Welt avancierte Cola etwas zeitversetzt zu einem Verkaufsschlager.
Die originale Coca-Cola-Formel (Merchandise 7X), die im Laufe der Jahre schon mehrmals geändert wurde, liegt seit 2011 im Coca-Cola-Museum in Atlanta. Die Besucher bekommen dort allerdings nur den Behälter zu sehen, in dem sich die geheime Rezeptur befindet.
Text: Toralf Czartowski • Fotos: Unsplash.com, Pixabay.com, Public Domain







